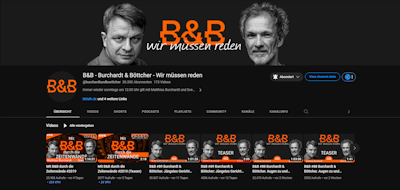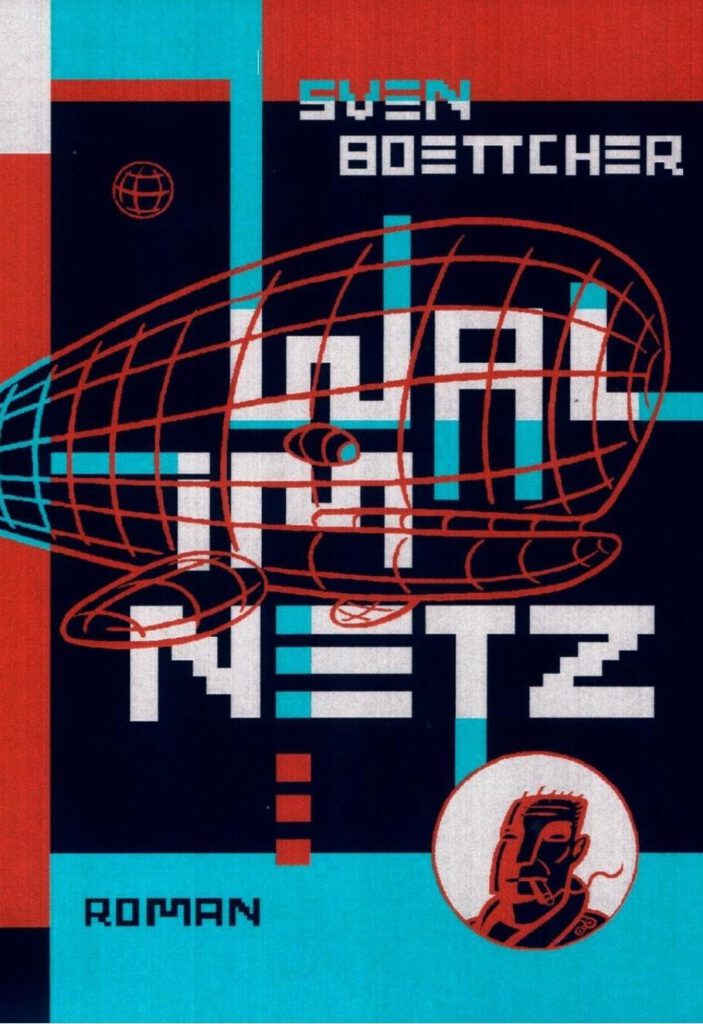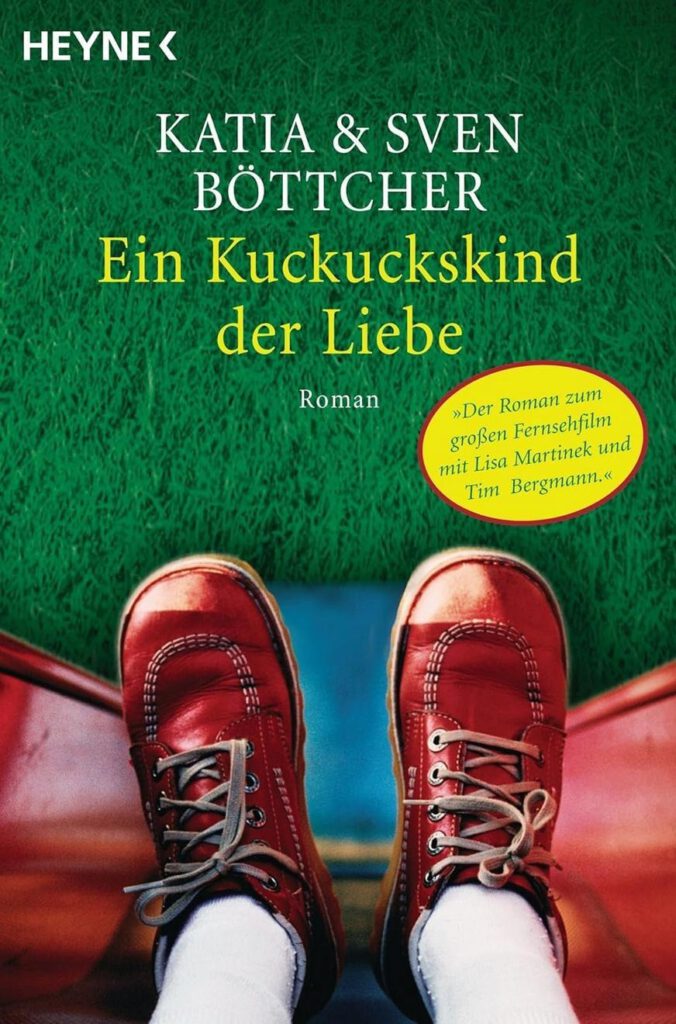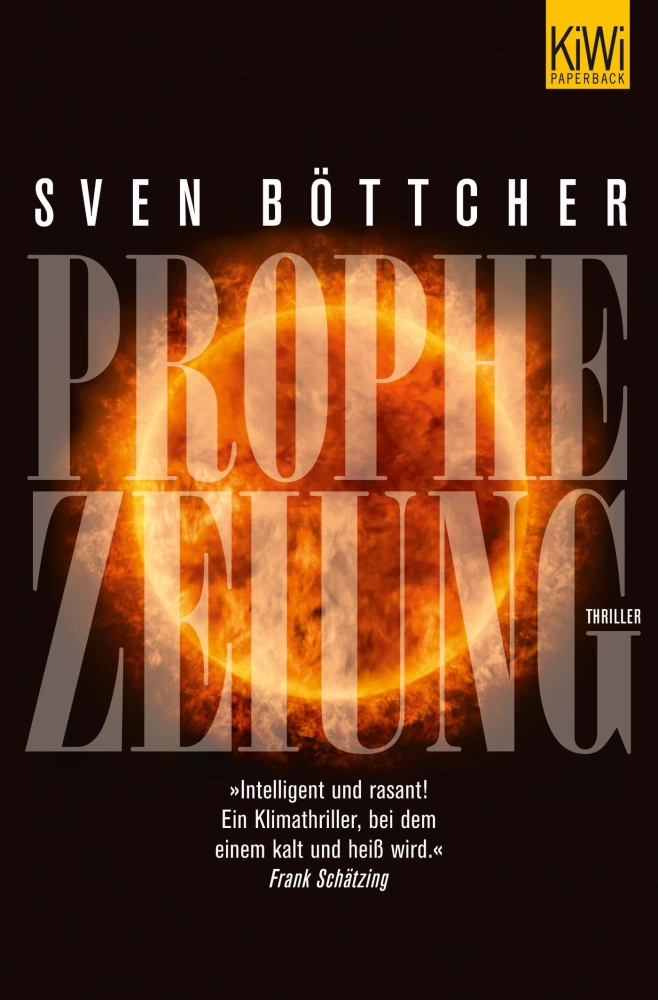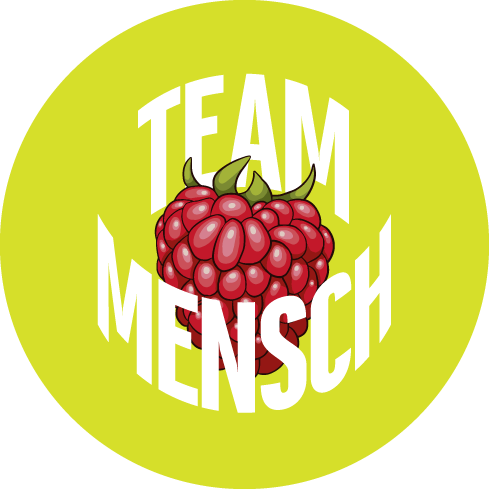Abblende. Und zwar bei uns bevorzugt auf die Themen „Krankheit“, „Sterben“ und „Tod“. Mit diesem Trio muss man sich ja nun weiß Gott nicht den Tag versauen, andererseits hat die Beschäftigung mit eben jenem natürlich nicht nur deprimierende Aspekte, sondern wirkt gehörig sinnstiftend in den Alltag hinein – gerade in den Alltag von Menschen, die noch nicht krank sind. Beziehungsweise gerade noch nicht sterben. Oder nicht mit „todkrank“ konfrontiert sind.
Deshalb gestatte ich mir die Weiterreichung einer Empfehlung meiner neuseeländischen Freundin A., die vor der erschütternden Verletzung ihres Hauses in Christchurch immerhin noch Gelegenheit hatte, mir Lionel Shriver ans Herz zu legen, genauer: So much for that, einen absolut großartigen Roman (der im März 2011 endlich auch auf Deutsch erscheint, unter dem Titel Dieses Leben, das wir haben).
Der „Plot“ ist simpel: Ein ehrlicher und tapferer Gutmensch (Shep), beschließt mit zirka Ende vierzig, endlich zu tun, was er immer wollte. Nämlich ins „Afterlife“ umzuziehen, zu Lebzeiten – in die Sonne, an den Strand, auf eine Insel im indischen Ozean, wo es sich von einem Dollar pro Tag gut leben lässt. Shep besitzt, da er vor einem Jahrzehnt seine Firma verkauft hat, fast eine Dreiviertelmillion Dollar, das wird auf Pemba bis zum Lebensende reichen, für ihn, seine Frau und seinen sechzehnjährigen Sohn. Shep, der gute Mann, bereitet alles vor, bucht Flüge, packt seine Taschen und stellt seine Frau vor vollendete Tatsachen: Ich gehe – und freue mich, wenn ihr beide mitkommt. Was sie (eine sagenwirmal schwierige Pseudokünstlerpersönlichkeit) prinzipiell sogar vorstellbar findet, mit einer kleinen Einschränkung. Sie müsste vorher noch mal kurz auf die gemeinsame Krankenversicherung zurückgreifen, denn wie sie seit einigen Tagen weiß, hat sie Krebs.
Im folgenden schickt Shriver ihren (ja, „Lionel“ ist eine Frau) Shep resp. Hiob erbarmungslos in den existenziellen Keller, Schritt für Schritt und unaufhaltsam. Sheps Frau Glynis hat mit ihrer wirklich fiesen und unheilbaren Krebsart eine Lebenserwartung von nur noch maximal einem Jahr, will davon aber nichts wissen, sondern Chemos, will wieder ganz gesund werden und irgendwen verklagen, der daran schuld ist. Denn irgendwer muss ja schuld sein, irgendeinen Asbesthersteller, irgendwo. Die gemeinsamen Freunde nehmen Anteil, weinen solidarisch und verkünden „Wenn wir irgendwas tun können …!“, um dann direkt im Anschluss an die Bekundungen nicht mehr ans Telefon zu gehen oder wahnsinnig viel unterwegs zu sein. Sheps künstlerische und Geschwister, Gefühlsmutanten und Hirnspender par excellence, erwarten weiter finanzielle Unterstützung vom „reichen“ Bruder, und natürlich fällt der greise Vater auch noch die Treppe runter und muss kurz ins Heim. Oder auch länger. Während Sheps Sohn eh nur noch wortkarg virtuell lebt, bis nach Südjapan vernetzt mit anderen grundlos depressiven Jugendlichen.
Gutmensch Shep wird zum Pfleger seiner todkranken Frau, obwohl die Ehe längst keine mehr war, vertagt seinen „Afterlife“-Plan, selbstredend, und wir dürfen zusehen, wie sein Leben und seine Träume (sowie natürlich sein Vermögen) rasant vernichtet werden.
Das bemerkenswerte an Shrivers Parabel ist, dass sie so verflucht sachlich ist und nie künstlich bitter gerät. Jeder kennt die Menschen, die Shep umgeben, aus seinem eigenen Leben, und jeder, der die Destruktion des guten Mannes verfolgt, weiß, dass es ihm (oder ihr) genauso ginge.
Shep hat keine Chance. Zugegeben, die Begleitumstände sind, da amerikanisch, brutaler als in unserem kuschligen AOK-Land, womit Shriver die totale materielle Vernichtung ihres Protagonisten etwas flotter gelingt, dennoch ginge auch ein deutscher „Shep“ binnen 12 bis 24 Monaten komplett vor die Hunde.
Es ist fast unerheblich, wie „happy“ das Ende eines solchen Romans überhaupt geraten kann (verblüffend, übrigens), denn die Frage, die er aufwirft, ist unabhängig vom Ausgang (zumal der ja in jedem Leben der gleiche ist): Wie sollen wir unser Leben leben? Wie lange wollen wir unsere Träume Träume sein lassen – und den Beginn unseres Lebens auf „später“ verschieben? Bis uns jemand die Entscheidung abnimmt? Und den Weg ein für alle mal versperrt? Das wär´s dann gewesen, eben: So Much For That.
Wer indes gerade keine Zeit oder keine Lust auf einen 500 Seiten dicken Hiobs-Roman hat, wohl aber der Frage „Was soll´n das hier eigentlich werden?“ nicht permanent ausweichen mag, der investiere 2 Stunden wahlweise in Nick Cassavetes ebenso traurigen wie lebensbejahenden Film My sister´s keeper, in den zu Unrecht vergessenen Marvin´s Room oder, etwas deutscher, Ben Verbongs Krebssterbekomödie Ob ihr wollt oder nicht. Alle drei helfen dem seiner Wurzeln beraubten Vollstädter, sich behutsam geführt den Grenzen seiner Existenz zu nähern. Was dann am Ende so oder so nicht zu Kummer oder Selbstmitleid führt, sondern zur Verinnerlichtung der Top 2 der ewigen Aphorismen-Charts: Memento Mori. Carpe diem.
Sparen kann man sich hingegen – als ggf. Selbstkranker – die Lektüre von Tim Parks: Die Kunst, stillzusitzen, sowie das neue Buch der von mir hochgeschätzten Caroline Myss. Die nämlich in Defy Gravity auf ihrem Weg von der „medialen Heilerin“ zur Mystikerin in den Fußstapfen der heiligen Theresa von Avila („Die innere Burg“ = Myss´ „Entering the Castle“) nun endlich bei der Erkenntnis angekommen ist, dass es gewisse Dinge gibt, die wir eben nicht selbst vollständig heilen können. Und zwar nicht nur z. B. abgefahrene Beine, sondern auch einige andere abgefahrene Behinderungen.
Was beides, alles und sowieso nicht weiter schlimm ist, aber das hatte Myss in ihrem direkt vom Kosmos diktierten Buch Why people don´t heal and how they can bereits endgültig und endgültig awe-inspiring formuliert. Defy Gravity ist weniger, denn Defy Gravity lässt sich auf eine simple Formel bringen: Letztlich liegt alles nicht in Deiner Hand. Sondern in denen höherer Mächte. Sich deren Gnade zu überantworten, ist eine herrlich gute und richtige Idee. Aber keine besonders neue, und keine, die man auf 250 Seiten auswalzen muss. Es tut auch ein schlichter Absatz, ungefähr so:
Genieß Deine temporäre Existenz (mit oder ohne Beine), solange sie dauert, sei dankbar für das Gute, das Du erlebst, und trage Deine Last wie ein Mann resp. eine Frau. Führe ein gutes Leben, im Sinne der ewigen Regeln, die Deine Seele als ewig gültig kennt (falls nicht: check Jesus´, vor allem die letzten Meter, und den Kernsatz des ollen Kant). Im übrigen: Hilf Dir selbst, dann helfen Dir die Götter. Und mach dir keine Sorgen, denn Du gehst ja in diesem Kosmos nicht verloren. Wohin denn auch?